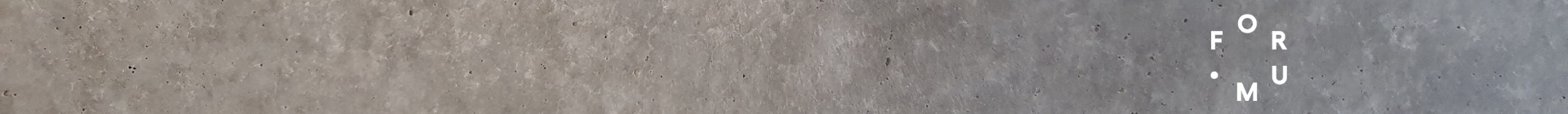Unten finden Sie die Termine und detaillierten Informationen zu unseren akutellen Veranstaltungen. Sie möchten keine Veranstaltung verpassen? Der freundliche Kalenderassistent stellt Ihnen regelmäßig die Inhalte unseres Veranstaltungskalenders zusammen und verschickt diese per E-Mail (einfach anmelden!)
Den Kalender mit den Terminen der Lehrveranstaltungen des FORUM finden Sie hier.