Die Ringvorlesung Wissenschaft in der Gesellschaft findet das nächste Mal im Sommersemester 26 statt
Hier geht’s zur Ringvorlesung aus dem vergangenen Sommersemester 25
Ringvorlesung Wissenschaft in der Gesellschaft
↵
| Zeit: | Montag, 15.45 – 17.15 |
| Ort: | Geb. 50.28 / InformatiKOM II, SR 2 KIT Campus Süd, Adenauerring 10 |
Jede Woche wird von unterschiedlichen KIT-internen und -externen Dozierenden ein Thema vorgestellt, das grundlegend zum Verständnis der Austauschprozesse von Wissenschaft und Gesellschaft beiträgt und speziell das Einwirken wissenschaftlicher Einflüsse in gesellschaftliche Kontexte erforscht.
Die Vorlesung beinhaltet 13 Vorträge, davon 12 innerhalb folgender Themenblöcke:
- Das Wissenschaftssystem
- Wissenschaft und Öffentlichkeit
- Wissenschaft und Wirtschaft
- Wissenschaft und Politik
- Wertediskurse
Studierende können sich ab 10. April 2025, 12 Uhr über das Campus Plus Portal anmelden.
Gasthörende und Gäste zu Einzelterminen melden sich bitte per E-Mail an unter ringvorlesung∂forum.kit.edu.
Montag, 28. April 2025, 15.45 Uhr
Einführung: Dynamiken öffentlicher Kontroversen um Umwelt, Technologie und Wissenschaft
 |
Prof. Dr. Senja Post
Wenn wissenschaftliche Befund in der Öffentlichkeit diskutiert werden, werden sie nicht mehr nur nach wissenschaftlichen, sondern auch nach normativen Kriterien beurteilt – also zum Beispiel danach, ob bestimmte Befunde gesellschaftlich erwünscht oder unerwünscht sind oder ob sie Argumente für erhoffte politische Ziele liefern. Hieraus können spezifische Dynamiken in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um Umwelt, Technologie und Wissenschaft erwachsen, an denen unterschiedlichen Akteure – aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft oder Zivilgesellschaft – beteiligt sind. Ziel dieser Sitzung ist es, diese Sachverhalte an ausgewählten Fallstudien zu verdeutlichen und dabei Problemstellung und Relevanz der Ringvorlesung zu verdeutlichen. |
Montag, 5. Mai 2025, 15.45 Uhr
Gute wissenschaftliche Praxis – Qualitätssicherung im Wissenschaftssystem
 |
Prof. Dr. Frank Simon
Wissenschaftliche Integrität ist eine zentrale Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit, und Voraussetzung für Vertrauen in die Forschung. Dies bezieht sich sowohl auf methodische Aspekte als auch Fragen des Umgangs mit und der Speicherung von Forschungsdaten, der Autorinnen- und Autorenschaft und mit geistigem Eigentum. Der Vortrag gibt einen Überblick über wichtige Aspekte der guten wissenschaftlichen Praxis sowie über typische Konfliktsituationen, den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten und das Ombudssystem am KIT. |
Montag, 12. Mai 2025, 15.45 Uhr
Technikgeschichte. Ein ‚kleines Fach‘ mit großen Themen
 |
Prof. Dr. Marcus Popplow
Technik ist nicht erst seit der Industrialisierung von entscheidender Bedeutung für die Menschheit. Dennoch widmen sich von den mehreren hundert Geschichtsprofessuren in Deutschland nur etwa ein Dutzend technikhistorischen Themen. |
Montag, 19. Mai 2025, 15.45 Uhr
Liebe zur Wissenschaft, unbezahlte Arbeit und die lieben Kollegen: Historische Perspektiven auf Frauen im Wissenschaftssystem
 |
Prof. Dr. Beate Ceranski
Die Teilhabe von Frauen an Naturforschung und Technik - auf diese Gebiete konzentriert sich der Vortrag thematisch - wurde und wird bis heute von ganz unterschiedlichen Faktoren und Perspektiven geprägt. Neben den Zugangsmöglichkeiten zum jeweiligen Wissen waren auch die Bedingungen, unter denen Frauen arbeiteten, ganz verschieden. So blieb etwa die unbezahlte Arbeit als Tochter oder Ehefrau im Familiensystem eines Wissenschaftlers oft unsichtbar, während Frauen unter Kriegsbedingungen bezahlte Stellen einnehmen konnten, die vorher unzugänglich waren. Neben der großen Begeisterung für ihre Arbeit waren loyale oder sogar fördernde Kollegen eine wichtige Ressource für ein Leben, das oft kein Rollenvorbild hatte. Nicht zuletzt lassen sich die Hürden für Frauen auf dem Weg zur Teilhabe nicht nur als Geschichten von Macht und Unterdrückung lesen, sondern auch als spannende Hinweis darauf, wie sehr Naturwissenschaftler und Ingenieure ihre männliche Identität mit ihrer Tätigkeit verbanden. |
Montag, 26. Mai 2025, 15.45 Uhr
Wissen und Rechtfertigung: Impulse aus der Philosophie
 |
Dr. Inga Bones
Einerseits prägen wissenschaftliche Erkenntnisse unser gesellschaftliches Leben, andererseits wird „der Wissenschaft“ heute von manchen Seiten attestiert, sie stecke in einer Vertrauenskrise. Nach den Möglichkeiten und Grenzen, den Zielen und Methoden wissenschaftlicher Praxis fragt die philosophische Disziplin der Wissenschaftstheorie. In dieser Vorlesung werden wissenschaftstheoretische Grundbegriffe – Wahrheit, Wissen, Rechtfertigung, Erklärung etc. – vorgestellt und die Frage erörtert, inwieweit wir wissenschaftlichen Resultaten vertrauen dürfen. |
Montag, 2. Juni 2025, 15.45 Uhr
Klimamodelle verstehen und nutzen
.jpg) |
Dr. Hans Schipper
Klimamodelle sind wesentliche Werkzeuge, um die Funktionsweise unseres Klimas zu verstehen und Aussagen über zukünftige Klimaentwicklungen zu treffen. Dieser Vortrag behandelt die Grundlagen und Anwendungen von Klimamodellen, wobei sowohl die physikalischen und mathematischen Prinzipien als auch die Komplexität regionaler Klimaentwicklungen behandelt werden. Anhand zahlreicher Beispiele wird ein vertieftes Verständnis für die Funktionsweise und Bedeutung von Klimamodellen in der Klimaforschung vermittelt. Die Studierenden lernen, welche Aussagen Klimamodelle über mögliche zukünftige Klimaszenarien treffen können und wo ihre Grenzen liegen. |
Montag, 16. Juni 2025, 15.45 Uhr
Wissenschaft im Fokus? Ausmaß und Struktur öffentlicher Thematisierung von wissenschaftlichen Ergebnissen und Expertisen
 |
Prof. Dr. Markus Lehmkuhl
Folgt man einschlägigen Diagnosen zum Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit, dann hat sich einiges geändert. Wissenschaft stehe unter öffentlicher Dauerbeobachtung, sei mehr und mehr genötigt, sich öffentlich zu erklären und um Akzeptanz zu werben und gerate in der breiten Öffentlichkeit immer häufiger in die Fänge ideologisierter politischer Kontroversen. Plausibilisieren lassen sich derartige Diagnosen durch den Verweis auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit wie die Transformation der Energiesysteme oder die Bekämpfung von Pandemien. Tatsächlich ist die Präsenz der Wissenschaft in der breiten, durch Massenmedien vermittelten politischen Öffentlichkeit allerdings nachwievor eher sporadisch. Fokussierte öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich nur äußerst selten auf relevante Erkenntnisse und Expertisen. |
Montag, 23. Juni 2025, 15.45 Uhr
+++ ENTFÄLLT +++ Wissenschaftsjournalismus: Welche Funktionen hat er und kann er diese erfüllen?
|
|
Der Vortrag muss leider kurzfristig aufgrund von Krankheit entfallen.
Prof. Dr. Annette Leßmöllmann
Wissenschaftsjournalismus wurde lange als eine Art Transmissionsriemen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit betrachtet, der wissenschaftliches Wissen mit geeigneter Übersetzung für ein Laienpublikum aufbereitet. Diese Funktion hat sich geändert, die Rolle des Wissenschaftsjournalismus wird heute differenzierter gesehen, und sie hat sich differenziert. Wissenschaftsjournalismus findet sich heute zudem in vielen Formen und Formaten wieder, und auch sein Publikum und dessen Mediennutzung hat sich pluralisiert. Im Vortrag gebe ich einen Überblick über die Facetten dieses Berufsfeldes aus Forschungs- und Praxissicht, und ich diskutiere die Funktionen, die Wissenschaftsjournalismus in der heutigen Gesellschafts- und Medienlandschaft übernehmen kann – und wo er auf Herausforderungen stößt. |
Montag, 30. Juni 2025, 15.45 Uhr
Wissenschaft und Politik
 |
Prof. Dr. Senja Post
Wissenschaft stellt in modernen Gesellschaften eine bedeutsame Wissensressource dar, die zu gesellschaftlichen Problemdiagnosen und zur Entwicklung effektiver Lösungen beitragen kann. Doch wie kann und soll Wissenschaft in politisches Handeln einfließen? Die Antwort auf diese Frage liegt in einem Spannungsfeld, das sich aufspannt einerseits durch die Erwartung, dass Politik möglichst rational und effektiv sein sollte und andererseits durch die Tatsache, dass politisches Handeln nie nur auf Wissen, sondern immer auch auf Werturteilen beruht, die wissenschaftlich nicht begründet werden können. In dieser Sitzung behandeln wir dieses Spannungsfeld aus erkenntnistheoretischer und demokratietheoretischer Perspektive. |
Montag, 7. Juli 2025, 15.45 Uhr
Wissenschaftliche Politikberatung: Wirkungsweisen und Herausforderungen des Zusammenspiels Wissenschaft und Politik am Beispiel der Innovations- und Systemforschung
 |
Prof. Dr. Jakob Edler
Immer häufiger wird gefordert, dass Politik evidenzbasiert und auf Beratung der Wissenschaft bauen soll. Gesellschaft und Politik haben dementsprechend die Erwartung, dass Wissenschaft relevante Konzepte und Evidenz bereitstellt. Gleichzeitig hat die Wissenschaft den Anspruch, nicht nur dem Erkenntnisgewinn zu dienen, sondern auch in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik Niederschlag zu finden. Aus diesen gegenseitigen Erwartungen erfolgt nun aber kein harmonisches oder gar stabiles Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Vielmehr stehen das Evidenzangebot der Wissenschaft und die Evidenznachfrage der Politik in einem komplexen Wechselspiel. Das hat nicht zuletzt mit den internen Handlungslogiken und Anreizsystemen der Teilsysteme Politik und Wissenschaft zu tun. Zudem sind unterschiedliche Bereiche und Disziplinen der Wissenschaft in unterschiedlichem Ausmaß umsetzungs- und problemorientiert.
In diesem Vortrag wird dieses komplexe Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Politik anhand einiger ausgewählter Forschungsfelder diskutiert. Diese Felder, die man in ihrer Gesamtheit der System- und Innovationsforschung zurechnen kann, zeichnen sich dadurch aus, dass Sie trotz aller Unterschiedlichkeit ganz besonders der Anwendungsorientierung verpflichtet sind. Der Vortrag stellt ein Konzept vor, mit dem das Zusammenwirken von Politik und Forschung über einen historischen Zeitraum von fünfzig Jahren beschrieben wird und zeichnet nach, wie sich die Forschungsfelder über die Jahre im Wechselspiel mit der Politik verändert haben. Daraus werden Lehren für eine angemessen wissenschaftliche Praxis gezogen, die der Politik in Zeiten zunehmender Wissenschaftsskepsis einerseits und zunehmender Evidenzerwartung andererseits konstruktiv helfen kann und dabei den wissenschaftlichen Prinzipien treu bleibt. |
Montag, 14. Juli 2025, 15.45 Uhr
Unternehmertum als Treiber eines gelingenden Strukturwandels
|
|
Prof. Dr. Orestis Terzidis Institut für Entrepreneurship, Technologiemanagement und Innovation (EnTechnon), KIT
Strukturwandel ist ein dynamischer Prozess, in dem sich die Form und Organisation von Wertschöpfung stetig verändert – angestoßen durch technologische Innovationen, gesellschaftliche Entwicklungen, politische Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Umbrüche und ökologische Herausforderungen. In diesem Kontext kommt dem Unternehmertum eine zentrale Rolle zu: Unternehmerische Akteure erkennen neue Chancen, entwickeln innovative Geschäftsmodelle, erschließen neue Märkte und gestalten aktiv den Wandel. Der Vortrag gibt einen ersten Einblick in diese Prozesse und zeigt auf, wie verantwortete unternehmerische Initiativen zum Gelingen eines nachhaltigen und zukunftsfähigen Strukturwandels beitragen können. |
Montag, 21. Juli 2025, 15.45 Uhr
Forschungsethik der Künstlichen Intelligenz: Zwischen Objekt und Werkzeug
 |
PD Dr. Alexander Bagattini
Die rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) stellt die Forschung vor tiefgreifende ethische Herausforderungen – sowohl dort, wo KI selbst Gegenstand der Forschung ist, als auch dort, wo sie als Werkzeug in wissenschaftlichen Prozessen eingesetzt wird. Der Vortrag beleuchtet diese beiden Dimensionen der Forschungsethik im Kontext von KI.
Im ersten Teil wird diskutiert, welche ethischen Fragen die Erforschung und Entwicklung von KI aufwirft. Dazu zählen etwa die Verantwortung für mögliche Fehlfunktionen, gesellschaftliche Auswirkungen von Automatisierung, Verzerrungen durch Trainingsdaten sowie der Umgang mit Autonomie und Kontrolle bei lernenden Systemen. Welche Normen und Prinzipien sollten die Forschung an Systemen prägen, deren Verhalten sich nur begrenzt vorhersagen lässt? Im zweiten Teil wird erörtert, wie sich die Rolle der Forschung verändert, wenn KI-gestützte Werkzeuge. etwa für Datenanalyse, Texterstellung oder Hypothesengenerierung, selbst Teil des wissenschaftlichen Prozesses werden. Hier stellen sich Fragen nach Transparenz, Reproduzierbarkeit, Autor*innenschaft, Bias und epistemischer Integrität. Kann eine Forschung, die sich KI als Assistenz bedient, noch als menschlich kontrolliert gelten – und wo verlaufen dabei die ethischen Grenzen?
Im Vortrag soll diese Doppelfunktion von KI als Forschungsgegenstand und -instrument kritisch diskutiert und anhand einschlägiger Fallbeispiele verdeutlicht werden. |
Montag, 28. Juli 2025, 15.45 Uhr
Genese, Verbreitung und Sicherung von Wissen
|
|
Prof. Dr. Michael Mönnich
Der Vortrag verdeutlicht, wie sich der Umgang mit Wissen durch gesellschaftliche und technologische Entwicklungen kontinuierlich wandelt und welche Perspektiven sich daraus ergeben. Historische Beispiele wie die Entwicklung von der Alchemie zur modernen Chemie und die Entstehung des wissenschaftlichen Publikationswesens – von kirchlicher Kontrolle über Akademien und Zeitschriften bis hin zu Open Access – zeigen die zunehmende Öffnung von Wissen. Ebenso hat sich die Auffindbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse gewandelt: von traditionellen Katalogen über digitale Datenbanken bis hin zur Nutzung von KI zur Recherche. Auch die Aufbereitung fachspezifischer Erkenntnisse hat sich verändert: Während früher Enzyklopädien dem Publikum Wissen vermittelten, übernimmt heute Wikipedia diese Rolle – künftig möglicherweise KI. Abschließend wird die dauerhafte Sicherung wissenschaftlicher Erkenntnisse betrachtet. Bibliotheken und Archive, die bis vor wenigen Jahren traditionell Dokumente auf Papier bewahrten, befassen sich heute mit der Langzeitarchivierung digitaler Daten und dem Management von Forschungsdaten. |
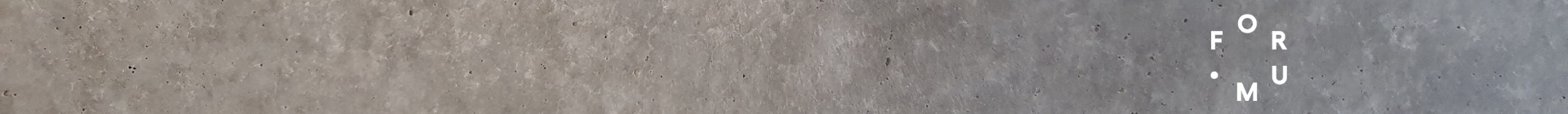
%20KIT%20Breig.jpg)

