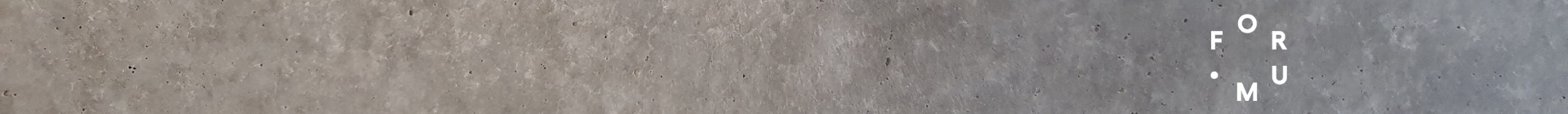Colloquium Fundamentale im Wintersemester 2025/26

Watt jetzt?
Energiewende zwischen Technologie und Teilhabe
Wie sieht die Energieversorgung von morgen aus? Kann es funktionieren, dass wir auf fossile Energieträger verzichten, während unser Energiebedarf weiter steigt? Was bedeutet dies für die Gesellschaft? Auf den ersten Blick mag die Energiewende als ein technisches Unterfangen erscheinen, tatsächlich aber ist sie eine umfassende gesellschaftliche Transformation, die unseren Alltag, unsere Arbeitswelt und unsere Fortbewegung betrifft. Technologische Lösungen bilden eine entscheidende Voraussetzung – doch ohne die Akzeptanz und aktive Beteiligung der Gesellschaft wird die Energiewende nicht gelingen. Deshalb ist es entscheidend, auch die normativen, sozialen und politischen Dimensionen in den Blick zu nehmen und uns zu fragen, welche Werte die Energiewende leiten, wer sie mitgestaltet (und wer nicht) und was sie gerecht macht.
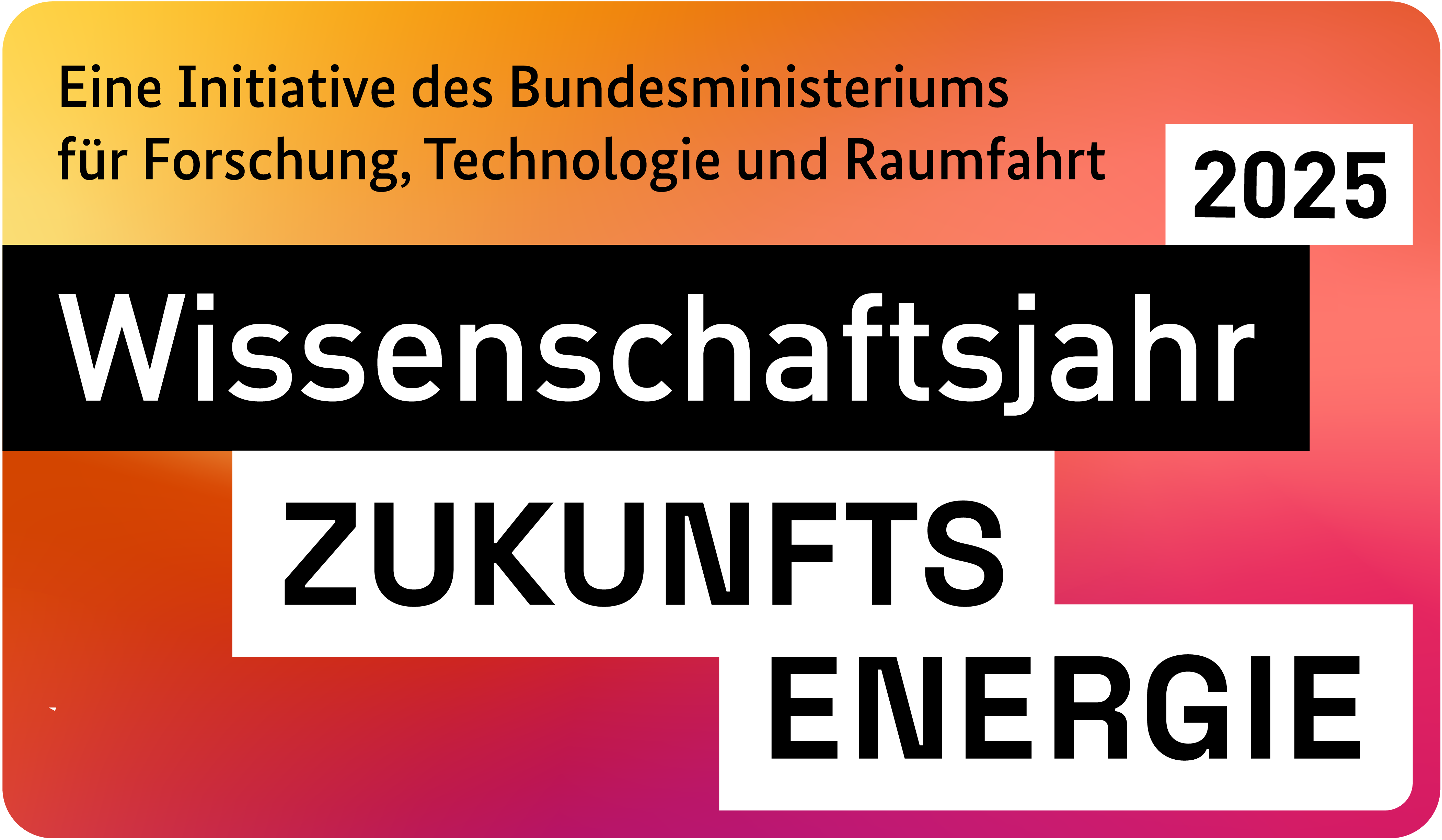
Wissenschaftliche Leitung: Dr. Doris Teutsch
Organisation: Leonie Klein, M.M., M.A.
Das Colloquium Fundamentale wird durch den KIT Freundeskreis und Fördergesellschaft e.V. gefördert.
Hinweis: Das Colloquium Fundamentale ist eine öffentliche Vortragsreihe, die alle Interessierten adressiert. Studierende, die für die Vortragsreihe einen Leistungsnachweis (2 LP) erwerben möchten, finden nähere Informationen beim Klicken auf den untenstehenden Pfeil. Alle weiteren Interessierten können ohne Anmeldung an der öffentlichen Veranstaltung teilnehmen.
Hinweis für Studierende
Studierende, die im Wintersemester 2025/26 einen Leistungsnachweis erwerben möchten, nehmen regelmäßig an der Vortragsreihe teil und beteiligen sich aktiv an der Diskussion. Zudem fertigen sie zwei Lernprotokolle zu zwei der besuchten Sitzungen an.
Studierende, die die Veranstaltung im Rahmen des Begleitstudiums Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft belegen, beantworten zusätzlich noch eine Leitfrage (6000 Zeichen). Die Liste der Leitfragen wird zu Semesterbeginn im Iliaskurs des Colloquium Fundamentale für angemeldete Studierende veröffentlicht.
Veranstaltungsübersicht
Sonnenenergie aus Plastikfolien – Herausforderungen der Energiewende am Beispiel der Photovoltaik
Donnerstag, 6. November 2025, 18 Uhr
Atrium im InformatiKOM, Geb. 50.19, KIT Campus Süd, Adenauerring 12
|
|
Prof. Dr. Alexander Colsmann
Abstract Obwohl Silizium-Solarzellen inzwischen ausgereift, kostengünstig und weit verbreitet sind, erfordert die Energiewende innovative Ansätze zur Nutzung der Sonnenenergie. Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, müssen neue Flächen für die Energieproduktion erschlossen, die Herstellungskosten von Solarmodulen gesenkt und die Umweltbilanz der Technologie verbessert werden. Hier kommen alternative Technologien wie organische Solarzellen ins Spiel. Sie bieten nicht nur Potenzial zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs, sondern eröffnen auch neue Möglichkeiten, Photovoltaik in bisher ungenutzte Bereiche zu integrieren – etwa in die Landwirtschaft, in Gebäudefassaden oder auf versiegelte Flächen. Die Energiewende bringt viele technische und soziale Herausforderungen mit sich, die hier am Beispiel der Photovoltaik diskutiert werden.
Kurzbiographie ⊻Prof. Dr. Alexander Colsmann studierte Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er 2003 sein Diplom erhielt. Im Jahr 2008 wurde er für seine Dissertation „Ladungsträger-Transportschichten für effiziente organische Halbleiterbauelemente” an der Universität Karlsruhe (TH) zum Doktor promoviert. Im Jahr 2016 schloss er seine Habilitation ab. Seit 2020 ist er Professor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und leitet ein multidisziplinäres Forschungsteam im Bereich Photovoltaik. Er ist Mitglied des Vorstands des KIT-Materialforschungszentrums für Energiesysteme (MZE) und Sprecher des Themenbereichs „Energieversorgung” innerhalb des KIT-Energiezentrums. |
Die Energiewende zwischen Politik, Risiko und Finanzierung
Donnerstag, 20. November 2025, 18 Uhr
Atrium im InformatiKOM, Geb. 50.19, KIT Campus Süd, Adenauerring 12

Im Rahmen von RegioCOP30
|
|
Dr. Barbara Breitschopf
Abstract Die Energiewende ist nicht nur ein technologisches, sondern vor allem ein politisches und finanzielles Projekt. Der Vortrag beleuchtet, wie politische Rahmenbedingungen die Transformation steuern können, welche Risiken sich aus politischen, technologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren ergeben und wie diese im Zusammenhang mit Finanzierungsfragen stehen. Im Fokus steht die Frage, wie Politik Investitionen erleichtern kann – und wie Lasten zwischen Staat, Wirtschaft und Verbrauchern verteilt werden können.
Kurzbiographie ⊻Dr. Barbara Breitschopf studierte Allgemeine Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim mit Schwerpunkt Entwicklungspolitik. Nach einem Traineeprogramm bei der Landesbank Baden-Württemberg im Bereich Infrastrukturfinanzierung erwarb sie einen Master of Arts in Economics an der Ohio State University und promovierte an der Universität Hohenheim. Parallel war sie als Gutachterin für Organisationen der internationalen Zusammenarbeit tätig. Anschließend arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Innovationsökonomik an der Universität Karlsruhe sowie als wissenschaftliche Assistentin am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI). |
Wind- und Solarenergie vor Ort – was Akzeptanz beeinflusst
Donnerstag, 27. November 2025, 18 Uhr
Atrium im InformatiKOM, Geb. 50.19, KIT Campus Süd, Adenauerring 12
|
|
Prof. Dr. Gundula Hübner
Abstract Seit inzwischen zwei Jahrzehnten liegt Forschung zur Akzeptanz Erneuerbarer Energien vor. Zwei Akzeptanzfaktoren haben sich als besonders zentral für die Umsetzung von Projekt vor Ort erwiesen: der Planungsprozess sowie Auswirkungen auf Anwohnende. Internationale wie nationale Forschungen zu den Auswirkungen, u. a. aus dem Raum der Schwäbischen Alb, gehen der Frage nach, ob und wenn ja, welche Belästigungen erlebt werden und welche Minderungsansätze möglich sind. Auch bei der Belästigungsfrage spielt die Zufriedenheit mit dem Planungsprozesse eine Rolle. Welche, und wie positive Planungen gefördert werden können, wird in diesem Vortrag beispielhaft anhand aktueller Projekte vorgestellt. Zudem wird auf die Frage eingegangen, warum die mehrheitlich positive Meinung zur Windenergie häufig unter-, die Ablehnung dagegen überschätzt wird.
Kurzbiographie ⊻Prof. Dr. Gundula Hübner lehrt und forscht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) sowie an der MSH Medical School Hamburg als Sozial- und Umweltpsychologin. An der MLU leitet sie die Arbeitsgruppe Gesundheits- und Umweltpsychologie. Im Fokus ihrer wissenschaftlichen Arbeit stehen die Akzeptanz Erneuerbarer Energien sowie deren Auswirkungen auf Anwohner, z. B. Stresswirkungen von Windenergieanlagen, u. a. in Kooperation mit dem KIT. In verschiedenen Projekten, mit interdisziplinären Teams, forscht sie zu positiver Bürgerbeteiligung, die lokale Identitäten, spezifische Situationen und Erfahrungen einzubeziehen. Hübner unterstützt u. a. die Bundesregierung bei der Beteiligung an einer internationalen Arbeitsgruppe zur sozialen Akzeptanz und Planung von Windenergieanlagen (Task 62) im Rahmen der Internationalen Energieagentur. Forschungsergebnisse für die Praxis nutzbar zu machen, ist ihr ein wichtiges Anliegen.
|
Die Zukunft der Antriebe – Wasserstoff, E-Fuels, Batterien?
Donnerstag, 18. Dezember 2025, 18 Uhr
Atrium im InformatiKOM, Geb. 50.19, KIT Campus Süd, Adenauerring 12
Veranstaltung auf YouTube | Veranstaltung auf KIT Medienportal
|
|
Prof. Dr. Maximilian Fichtner
Abstract Angesichts der Endlichkeit der fossilen Ressourcen und dem weiter ansteigenden Treibhausgaseffekt ist ein Umsteuern in verschiedenen Bereichen unseres Energiesystems zwingend erforderlich. Dazu gehört insbesondere auch der Verkehrssektor mit seinen bisher auf fossilen Kraftstoffen beruhenden Energiequellen. Diese bieten nur geringes Einsparpotential für Treibhausgase und müssen baldmöglichst und weltweit ersetzt werden.
Kurzbiographie ⊻Prof. Dr. Maximilian Fichtner ist Chemiker und Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm (HIU) für Elektrochemische Energiespeicherung, Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm, Leiter der Abteilung „Energiespeichersysteme“ am Institut für Nanotechnologie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sowie Honorarprofessor an der University of Wales in Swansea. |
Bitte wenden! Genderperspektiven als Beiträge zu einer transformativen Planung der Energiewende
Donnerstag, 15. Januar 2026, 18 Uhr
Atrium im InformatiKOM, Geb. 50.19, KIT Campus Süd, Adenauerring 12
Veranstaltung auf YouTube | Veranstaltung auf KIT Medienportal
|
|
Prof. Dr. Tanja Mölders
Abstract Die Energiewende stellt einen sozial-ökologischen Transformationsprozess dar, der auch die räumliche Planung vor neue Herausforderungen stellt. Während Planung lange Zeit als „Verhinderer“ der Energiewende galt, ist sie aufgrund der jüngsten gesetzlichen Änderungen (Windenergieflächenbedarfsgesetzes etc.) zu einem zentralen Akteur für den Ausbau erneuerbarer Energien geworden. Vor dem Hintergrund dieses Paradigmenwechsels stellt sich die Frage, wie die Energiewende sozial-ökologisch gerecht gestaltet werden kann, auch für die Planung dringender denn je. Im Vortrag wird diese Frage diskutiert, indem die Analyse- und Gestaltungspotenziale der Geschlechterforschung für die räumlichen Transformationsprozesse der Energiewende aufgezeigt werden. Dazu wird auf die theoretischen Zugänge und empirischen Erkenntnisse aus einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsprojekt zurückgegriffen.
Kurzbiographie ⊻Prof. Dr. Tanja Mölders ist seit 2023 Professorin für Umweltplanung und Transformation an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Sie studierte Angewandte Kultur- und Umweltwissenschaften an der Universität Lüneburg, wo sie auch promovierte (Dr. rer. soc.) und habilitierte (Venia legendi Nachhaltigkeitswissenschaften/Sustainability Sciences). Als wissenschaftliche Mitarbeiterin war sie an der Leuphana Universität Lüneburg (u. a. als Leiterin der Forschungsnachwuchsgruppe PoNa „Politiken der Naturgestaltung“) sowie an der Universität Hamburg tätig. Von 2013 bis 2020 war sie Juniorprofessorin für Raum und Gender an der Leibniz Universität Hannover. Im Anschluss leitete sie das wissenschaftliche Referat „Räumliche Planung und raumbezogene Politik“ an der ARL – Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft. Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind u. a. sozial-ökologische Transformationen, Geschlechterverhältnisse und Nachhaltigkeit sowie Gender Planning. |
Geopolitik der Energietransformation:
Europa im Spannungsfeld von Klimaschutz und Energiesicherheit
Donnerstag, 22. Januar 2026, 18 Uhr
Atrium im InformatiKOM, Geb. 50.19, KIT Campus Süd, Adenauerring 12
|
|
Prof. Dr. Rainer Quitzow
Abstract Der Aufbau neuer Energieinfrastrukturen und Industrien bringt neue Formen staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft und veränderte globale Wettbewerbsbedingungen mit sich. Der Vortrag skizziert diese Veränderungen und stellt die Frage, wie die EU vor diesem Hintergrund klimapolitische Ambition, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und geopolitischen Einfluss erhalten kann.
Kurzbiographie ⊻Prof. Dr. Rainer Quitzow leitet die Forschungsgruppe „Geopolitik der Energie- und Industrietransformation“ am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GFZ Helmholtz Zentrum für Geoforschung. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse des geoökonomischen Wettbewerbs in klimafreundlichen Industriezweigen sowie der Rolle von Außen- und Industriepolitik in diesem Kontext. Quitzow ist zudem Honorarprofessor für Nachhaltigkeit und Innovation an der Technischen Universität Berlin. |