Fotogalerie
FORUM@KSW Bilder
Videos von FORUM@KSW

Samstag 18.10.2025,
10.30-16.45 Uhr, IHK
%20klein_hell_x1230.jpg)
Samstag 18.10.2025,
19.00-23.30 Uhr, ZKM

Sonntag 19.10.2025,
11-13 Uhr, IHK
Öffentliches Symposium
Kommunalpolitik und Lokaljournalismus: Hüter der Demokratie im Kleinen?
Samstag, 18. Oktober 2025, 10.30-16.45 Uhr (Eintritt frei, ohne Anmeldung)
Industrie- und Handelskammer Karlsruhe, Saal Baden, Lammstr. 13–17
In den Räumen der 
Inwiefern nehmen Kommunalpolitik und Lokaljournalismus die Rolle der „Hüter der Demokratie im Kleinen“ ein? Mit welchen Problemen und Zukunftssorgen haben beide Bereiche zu kämpfen und was braucht unsere Demokratie, um stark zu bleiben? Das öffentliche Symposium beleuchtet in Kurzvorträgen und Diskussionsrunden diese und weitere Fragen mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Medien und der Politik. Diskutieren Sie mit!
|
|
Grußwort
Prof. Dr. Thomas Hirth
|
 |
Begrüßung
Prof. Dr. Senja Post Professorin für Wissenschaftskommunikation und wissenschaftliche Leiterin des Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM), KIT
|
Panel 1:
Demokratie vor Ort – Herausforderungen der Kommunalpolitik
 |
Starke Städte, starke Demokratie – kommunale Antworten auf aktuelle Herausforderungen
CV von Dr. Frank MentrupDr. Frank Mentrup studierte Medizin in Heidelberg und Mannheim und arbeitete anschließend am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim sowie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Städtischen Klinikum Karlsruhe.
AbstractUnter dem Titel „Starke Städte, starke Demokratie – kommunale Antworten auf aktuelle Herausforderungen“ beleuchtet Dr. Frank Mentrup die Lage der Kommunen in Zeiten wachsender Belastungen. Zunehmend enge finanzielle Spielräume, eine immer dichtere Bürokratie und der spürbare Anstieg an Anfeindungen gegenüber kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern setzen die lokale Demokratie unter Druck. Städte und Gemeinden bleiben dennoch zentrale Orte, an denen Bürgernähe, Beteiligung und demokratische Kultur gelebt werden. Der Vortrag will aufzeigen, wie Städte trotz schwieriger Rahmenbedingungen handlungsfähig bleiben, welche politischen und rechtlichen Weichenstellungen sie dafür benötigen – und warum starke Städte eine unverzichtbare Grundlage für eine starke Demokratie sind. |
.jpg) |
Daseinsvorsorge und Demokratie
CV von Prof. Dr. Claudia NeuClaudia Neu ist Professorin für Soziologie ländlicher Räume an den Universitäten Göttingen und Kassel. Von 2009 bis 2016 war sie Professorin für Allgemeine Soziologie und empirische Sozialforschung an der Hochschule Niederrhein. Sie studierte und promovierte an der Universität Bonn. Neu ist Vorsitzende des Sachverständigenrates „Ländliche Entwicklung“ beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat sowie stellvertretende Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats der Akademie für Raumentwicklung. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Demografie und Daseinsvorsorge, Zivilgesellschaft und Extremismus in ländlichen Räumen. Seit einiger Zeit beschäftigt sie sich auch mit dem Thema Einsamkeit.
AbstractDer ICE kommt zu spät, Brücken krachen zusammen und der Bus kommt auf dem Land gleich gar nicht mehr. Die Unzufriedenheit mit der Daseinsvorsorge ist in der Bevölkerung mit Händen zu greifen. Doch schwächt die marode Infrastruktur auch das Demokratievertrauen? Fühlen sich Landbewohner „abgehängt“, von der Politik im Stich gelassen und entfernen sich deshalb von der liberalen Demokratie, wenden sich gar rechtsextremen Positionen zu? Im Vortrag wird der Frage nach dem Zusammenhang von Daseinsvorsorge und Demokratie nachgegangen. |
.jpg) |
CV von Kirsten EberspachKirsten Eberspach, M.A., studierte Politikwissenschaften mit Schwerpunkt ‚Internationale Beziehungen‘ an der TU Kaiserslautern. Anschließend arbeitete sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin für ein Mitglied des Deutschen Bundestages. 2019 wechselte sie zur Forschungsstelle Extremismus/Terrorismus des Bundeskriminalamtes und leitet dort das Sachgebiet ‚Extremismusprävention‘. Zudem leitet sie das Projekt ‚Kommunales Monitoring zu Hass, Hetze und Gewalt gegenüber Amtsträgerinnen und Amtsträgern‘ (KoMo), ein Teilprojekt des Forschungsverbundes „Monitoringsystem und Transferplattform Radikalisierung“ (MOTRA). Das Projekt ist im Rahmen der zivilen Sicherheitsforschung angesiedelt und wird durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), Bundesministerium des Inneren (BMI) und Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.
AbstractBedrohungen, Anfeindungen und Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Straftaten gegen Amts- und Mandatsträgerinnen und -träger haben sich von 2019 bis 2024 bundesweit mehr als verdreifacht. Zur kontinuierlichen Beobachtung und Entwicklung präventiver Schutzmaßnahmen führt das BKA gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden (DST, DLT, DStGB) im Rahmen von MOTRA das „Kommunale Monitoring zu Hass, Hetze und Gewalt gegenüber Amtsträgerinnen und Amtsträgern“ (KoMo) durch. In dieser Dunkelfeldstudie werden bundesweit (Ober-)Bürgermeisterinnen und Landrätinnen online zu ihren Erfahrungen mit Anfeindungen und Übergriffen im Amtsalltag befragt. Bisher fanden sieben Befragungswellen statt, die ein hohes Maß an Anfeindungen belegen. Der Vortrag stellt zentrale Ergebnisse aus der Studie vor und zeigt erste Ansätze für eine zielgerichtete kommunale Präventionsarbeit auf. |
.jpg) |
Kommunal. Engagiert. Attraktiv. – Wie wir mehr Menschen für den Gemeinderat gewinnen
Prof. Dr. Oliver Junk
CV von Prof. Dr. Oliver JunkOliver Junk ist Professor für Verwaltungsrecht mit dem Schwerpunkt Kommunalrecht am Fachbereich Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Marburg und Bayreuth zwischen 1996 und 2001 promovierte er im Jahr 2006 mit einer Arbeit zum kommunalrechtlichen Thema „Das Konnexitätsprinzip in der Bayerischen Verfassung“. Seine wissenschaftliche Qualifikation verbindet er mit umfassender praktischer Erfahrung in der Kommunalpolitik: Von 2002 bis 2011 war er ehrenamtlicher Stadtrat in Bayreuth und im Anschluss daran zehn Jahre lang, von 2011 bis 2021, Oberbürgermeister der Stadt Goslar. Seine wissenschaftlichen und beruflichen Interessen gelten insbesondere der Stärkung lokaler Demokratien und der Weiterentwicklung kommunaler Selbstverwaltung. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung kommunaler Gremiensitzungen sowie auf der Entwicklung innovativer Partizipationsformate. Zudem engagiert er sich für die aktive Einbindung junger Menschen in kommunalpolitische Prozesse und setzt sich dafür ein, sie für die Mitgestaltung ihrer örtlichen Gemeinschaft zu gewinnen. Auch außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit ist Oliver Junk vielseitig engagiert. Er ist Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, Mitglied im Verbandsrat des vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung sowie Präsident des Harzklubs, eines traditionsreichen Heimat-, Natur- und Wandervereins mit über 10.000 Mitgliedern. In all seinen Tätigkeiten verbindet er wissenschaftliche Expertise mit praktischer Erfahrung und bürgerschaftlichem Engagement.
AbstractWer hat Zeit für die kommunale Selbstverwaltung? Lust auf lokale Demokratie? Wer macht mit in unseren Stadt- und Gemeinderäten? Die Erwartungen an die „Kommunalos“ sind hoch. Da sind zunächst die kommunalen Gremien. Monatlich tagt der Rat, dazwischen Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Aber Präsenzpflichten bestehen auch für Sommerfeste der Kindergärten, Jahreshauptversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren, dem Tag der Offenen Tür des Jugendzentrums und der Vernissage des heimischen Kunstvereins.
|
Diskussionsrunde mit den Panelisten, Moderation Dr. Doris Teutsch
13-14 Uhr Mittagspause
14 Uhr Fortführung des Symposiums (Einlass bis 14:45 Uhr möglich)
Panel 2:
Lokale Öffentlichkeit im Medienwandel: Perspektiven für Journalismus, Verwaltung und Gesellschaft
.jpg) |
Lokale Öffentlichkeiten im Wandel. Herausforderungen für die Interaktion von Kommunalverwaltungen, Intermediären und Bürgerschaft
CV von Prof. Dr. Olaf JanduraProf. Dr. Olaf Jandura ist außerplanmäßiger Professor für Kommunikationswissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Leiter des Forschungsschwerpunkts Communication Research@HSD. Communication in Media, Markets, and Society an der Hochschule Düsseldorf. Er studierte Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Soziologie an der TU Dresden und der Universidad de Navarra in Pamplona. Nach dem Masterabschluss und der Promotion in Dresden arbeitete er als akademischer Rat (a.Z.), Vertretungsprofessor und befristeter W2-Professor an der LMU München, der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und der Universität Zürich. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der politischen Kommunikation, der Medieninhaltsforschung sowie der Rezeptions- und Wirkungsforschung.
AbstractDie lokalen Öffentlichkeiten stehen unter erheblichem Transformationsdruck. Traditionelle Medienangebote wie Lokalzeitungen oder Anzeigenblätter verlieren an Reichweite und Integrationskraft. Gleichzeitig gewinnen digitale Plattformen, soziale Netzwerke und personalisierte Informationsumgebungen an Bedeutung – mit der Folge, dass sich die Öffentlichkeit fragmentiert und gemeinsame Kommunikationsgrundlagen schwinden. Bürgerinnen und Bürger verfügen heute über sehr unterschiedliche Informations- und Kommunikationsrepertoires, abhängig von Bildung, sozialem Milieu, Alter oder Medienkompetenz. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen für die lokale Demokratie. |
 |
Zukunft gesucht: Lokaljournalismus zwischen ökonomischem Druck und demokratischer Verantwortung
CV von Prof. Dr. Annika SehlProf. Dr. Annika Sehl ist Inhaberin des Lehrstuhls für Journalistik mit dem Schwerpunkt Medienstrukturen und Gesellschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Zudem ist sie Research Associate des Reuters Institute for the Study of Journalism an der University of Oxford und Affiliate Member des australischen Forschungszentrum ARC Centre of Excellence for Automated Decision-Making and Society (ADM+S).
AbstractLokaljournalismus hat eine wichtige Funktion für Information, Teilhabe und demokratische Kontrolle im direkten Lebensumfeld. Befragungen zeigen: Die Mehrheit der Bevölkerung hält lokale Berichterstattung für unverzichtbar. Doch das tradierte Geschäftsmodell aus Werbeeinnahmen, Abonnements und Verkaufserlösen bricht zunehmend weg, während digitale Erlöse bislang nur einen geringen Teil des Umsatzes ausmachen. Was aber geschieht, wenn immer mehr Redaktionen schließen und ganze Regionen drohen, zu sogenannten Nachrichtenwüsten zu werden? Der Vortrag beleuchtet aktuelle Entwicklungen, analysiert die Folgen für Öffentlichkeit und Demokratie und diskutiert Perspektiven – von neuen redaktionellen und ökonomischen Strategien der Verlage bis hin zu Formen öffentlicher Förderung. |
 |
Warum Presseförderung die Pressefreiheit stärkt
CV von Dr. h.c. Roger de WeckRoger de Weck ist Autor in Zürich und Gastprofessor am College of Europe in Brügge. Er war Mitglied des Zukunftsrats für Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk. 2024 erschien bei Suhrkamp sein jüngstes Buch «Das Prinzip Trotzdem – Warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen».
AbstractDie nordeuropäischen Länder belegen die Spitzenplätze in den Ranglisten der Medienvielfalt, des Medienvertrauens der Bürgerinnen und Bürger, der Medienfreiheit – und der Medienförderung. Deutschland sollte sich von den nordischen Fördermodellen inspirieren lassen. Denn was ist Pressefreiheit, wenn es immer weniger Presse gibt – oder wenn sie zusehends Oligarchen gehören wird? Die Länder und Bund sollten endlich auch für private Anbieter eine Medienpolitik entwickeln, genauer: eine gezielte Politik zur Unterstützung des Lokal- und Regionaljournalismus. |
.jpg) |
Was den Journalismus rettet: Authentizität, Relevanz – und warum das Medium zweitrangig ist
CV von Julia Baumann-ScheyerIm Kleinen das ganz Große entdecken, das ist die Leidenschaft von Julia Baumann-Scheyer. Im Journalismus, vor allem im Lokalen, kann sie genau das jeden Tag tun.
AbstractAuthentizität im Journalismus ist immer wichtig. Doch gerade im Lokalen ist sie entscheidend dafür, ob journalistische Inhalte von ihren Nutzerinnen und Nutzern als relevant erachtet werden – oder eben nicht. Während es zweitrangig ist, ob die Inhalte über gedruckte Zeitungen, Webseiten oder Newsletter verbreitet werden, hat es gravierende Folgen, wenn Inhalte ausschließlich auf Reichweite optimiert oder an die Funktionsweise von Algorithmen angepasst sind. Denn wenn Online-Inhalte zunehmend für ein breites, anonymes Publikum erstellt werden, verlieren die Menschen vor Ort das Vertrauen in „ihr“ Medium und das Gefühl, dass dort noch ihre Lebenswelt abgebildet wird. Dabei ist das Bedürfnis nach seriösen, gut recherchierten Inhalten gerade im Lokalen groß – und darum gerade hier eine Bereitschaft dafür da, dafür zu zahlen. |
Diskussionsrunde mit den Panelisten, Moderation: Prof. Dr. Senja Post
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Einlass ist jederzeit bis 14:45 Uhr möglich, auch wenn einzelne Vorträge bereits begonnen haben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTE-Filmnacht
Samstag, 18. Oktober 2025, 19-23.30 Uhr (Eintritt frei, ohne Anmeldung)
ZKM │ Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Medientheater, Lorenzstr. 19
Veranstaltung des FORUM in Kooperation mit ARTE und dem ZKM | Karlsruhe. Filmabend mit ARTE-Dokumentationen und Wissensserien.
„Film ab!“ heißt es bei der ARTE-Filmnacht, in deren Fokus die gesellschaftlichen Spannungen unserer Zeit stehen: Stadt-Land Kluft, Klimawandel, Wohnungsnot, politische Bedrohungen und die Frage, wie wir als Gesellschaft streiten, gestalten und zusammenleben wollen – heute und in Zukunft. Bei einem Late-Night-Imbiss besteht die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch.
| 19.00 Uhr |
Stadt / Land / Der große Graben FilmbeschreibungGehen Einwohnerzahlen zurück, muss gespart werden – so die Strategie der Politik für den ländlichen Raum. Deutschland will in der Verwaltung sparen und legt Gemeinden zusammen, in Frankreich werden Bahnhöfe und Geburtenstationen auf dem Land geschlossen. Doch wenn es bis zum Amt oder zum Arzt zwei Stunden Fahrt sind, steigt das Gefühl der Fremdbestimmtheit. In Polen galt der ländliche Teil als rückständig, wurde belächelt – und hat sich gewehrt. Für viele ist die Wahl der PiS ein gefährlicher Rechtsrutsch. Aber: Die Partei schafft es, die Landbevölkerung anzusprechen. |
| 20.00 Uhr |
Europa glüht. Wie Hitzewellen unser Leben verändern FilmbeschreibungSie ereignen sich immer häufiger, sie dauern länger und werden stetig intensiver: Hitzewellen. In Europa jagt ein Temperaturrekord den nächsten. Eine Frage treibt die Wissenschaft angesichts dieser Entwicklung ganz besonders um: Wie heiß wird es in Zukunft werden? Der Film reist zu westeuropäischen “Hotspots”, beleuchtet die vielfältigen Auswirkungen von Hitzewellen auf unser Leben und stellt mögliche Adaptionsstrategien vor. |
| 21.00 Uhr |
RE: Zielscheibe des Hasses – Bürgermeister im Visier der Rechten FilmbeschreibungWer ein Amt bekleidet und öffentlich für Menschenrechte eintritt, geht ein Risiko ein. Auf anonyme Hetze folgen immer öfter Taten. Einige Lokalpolitiker haben wegen rechter Morddrohungen bereits ihr Amt aufgegeben. Burkhard Jung, der Oberbürgermeister von Leipzig, sieht eine Strategie dahinter und will nicht, dass sie aufgeht, er macht weiter. Pierre Serne, Lokalpolitiker in Paris, geht kaum noch aus, schläft schlecht, hat 10 Kilo abgenommen. Der Aufruf von ultrarechten bewaffneten Neonazis, ihn zu eliminieren, beeinträchtigt ihn. Aber auch er steht zu seinen Überzeugungen und macht weiter. 42: Die Antwort auf fast alles – Sollten wir mehr streiten? FilmbeschreibungWir scheinen so zerstritten zu sein wie nie. Im Internet, in den Medien, bei der Familienfeier: Man könnte den Eindruck bekommen, dass wir alle gar nichts mehr gemeinsam haben! Und der Ton wird auch immer rauer. Wie kommen wir wieder zusammen? Was, wenn die Antwort ganz überraschend wäre? Wir müssen mehr streiten! |
| 22.00 Uhr |
Late-Night-Imbiss |
| 22.30 Uhr |
Agree to Disagree! Wohnungsnot bekämpfen, ohne neu zu bauen? FilmbeschreibungDie Mieten und Baukosten steigen und in den Großstädten fehlt massiv Wohnraum. Gleichzeitig ist Wohnen und Bauen ein echter Klimakiller, verantwortlich für 40% unserer CO2 Emissionen. Wie können wir in Zukunft mehr günstigeren Wohnraum schaffen – und zwar klimafreundlich? Geht das überhaupt beides? Oder müssen wir für den Klimaschutz eigentlich Neubauten gänzlich verbieten? Diese Fragen diskutiert Bertolt Meyer mit Tim Rieniets, Architekturprofessor der Universität Hannover, und Jan-Hendrik Goldbeck, Geschäftsführer eines der größten Bauunternehmens Europas. 42: Die Antwort auf fast alles – Muss Wohnen so teuer sein? FilmbeschreibungIn fast allen Städten Europas wird das Wohnen seit Jahren immer teurer. Überall dort, wo viele Menschen Arbeit oder Ausbildung suchen, internationale Unternehmen agieren und der Tourismus floriert, wird der Platz langsam knapp. Aber auf den wenigen Flächen, die noch bleiben, entstehen oft teure Eigentums- statt bezahlbare Mietwohnungen. Woran liegt das? Welche Faktoren sorgen – unabhängig von Konjunktur und Wirtschaftspolitik – dafür, dass die Nachfrage nach Wohnraum so enorm steigt? Warum hinkt das Angebot meist hinterher? Und was können wir tun, damit sich die Lage entspannt? |
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Einlass ist jederzeit möglich, auch wenn einzelne Filme bereits begonnen haben.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podiumsdiskussion: Zukunft – nur in der Stadt? Bruchlinien zwischen Stadt und Land
Sonntag, 19. Oktober 2025, 11-13 Uhr (Eintritt frei, ohne Anmeldung)
Industrie- und Handelskammer Karlsruhe, Saal Baden, Lammstr. 13–17
In den Räumen der 
Welche Spannungen bestehen zwischen Stadt und Land, Ost- und Westdeutschland? Und was verbindet uns? In der Podiumsdiskussion werden Unterschiede in Wirtschaft, Infrastruktur und Politik beleuchtet wie z.B. das Gefühl der mangelnden Repräsentation ländlicher Regionen auf Bundesebene. Expertinnen und Experten diskutieren unter der Moderation von Markus Brock (3sat/SWR). Im Anschluss findet ein Stehempfang statt, der Gelegenheit für Gespräche, Austausch und neue Perspektiven bietet.
_x155.jpg) |
Grußwort
|
 |
Begrüßung
|
 |
Moderation: Markus Brock
CV von Markus BrockMarkus Brock, geboren 1963, ist Fernsehmoderator bei 3sat und dem SWR. Seit vielen Jahren moderiert er dort Talkshows, Magazine und Reportagen, wie aktuell den MuseumsCheck auf 3sat. Brock studierte Politikwissenschaften und Soziologie in Heidelberg. Neben diversen weiteren Sendungen für ARD und ZDF moderierte der gelernte Redakteur zehn Jahre lang zahlreiche Radiosendungen bei SWF3. Heute ist er auf SWR Kultur zu hören. Des Weiteren moderiert Brock häufig Diskussionsveranstaltungen, Foren und Events zu den unterschiedlichsten Themen. Zu seinen Spezialgebieten gehören unter anderem Wissenschaft und Forschung, sowie Wirtschaft und Kultur. |
Es diskutieren:
.png) |
Dr. Ansgar Hudde
CV von Dr. Ansgar HuddeDr. Ansgar Hudde studierte Soziologie und Humangeographie und wurde 2019 im Fach Soziologie von der Universität Bamberg promoviert. Nach einem Postdoc an der LMU München sammelte er Erfahrungen als Referent im Bayerischen Verkehrsministerium und kehrte ein Jahr später in die Wissenschaft zurück. Seitdem ist er am Department für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität zu Köln tätig. Außerdem hatte er eine Vertretungsprofessur an der Goethe-Universität Frankfurt inne und war für Forschungsaufenthalte an der Sciences Po Paris und am Nuffield College der University of Oxford. Für das Frühjahr 2026 ist Hudde als Gastwissenschaftler an das Center for European Studies der Harvard University eingeladen. |
.jpg) |
Dr. Tim Leibert
CV von Dr. Tim LeibertTim Leibert ist Bevölkerungsgeograph und Senior Researcher in der Forschungsgruppe Mobilitäten und Migration am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig. Dort forscht er zum demographischen Wandel, internationalen und Binnenwanderungen in Deutschland und Mitteleuropa, Polarisierungs- und Peripherisierungsprozessen, „abgehängten Regionen“ sowie Regionalentwicklung in ländlichen Räumen. Tim Leibert hat an den Universitäten Mannheim und Heidelberg Geographie, Politikwissenschaften und Biologie studiert und an der Universität Leipzig promoviert. |
.jpg) |
Prof. Dr. Claudia Neu
CV von Prof. Dr. Claudia NeuClaudia Neu ist Professorin für Soziologie ländlicher Räume an den Universitäten Göttingen und Kassel. Von 2009 bis 2016 war sie Professorin für Allgemeine Soziologie und empirische Sozialforschung an der Hochschule Niederrhein. Sie studierte und promovierte an der Universität Bonn. Neu ist Vorsitzende des Sachverständigenrates „Ländliche Entwicklung“ beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat sowie stellvertretende Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats der Akademie für Raumentwicklung. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Demografie und Daseinsvorsorge, Zivilgesellschaft und Extremismus in ländlichen Räumen. Seit einiger Zeit beschäftigt sie sich auch mit dem Thema Einsamkeit. |
 |
Dr. Mandy Tröger
CV von Dr. Mandy TrögerMandy Tröger ist gebürtige Ost-Berlinerin. Sie studierte Geschichte (B.A.) an der Universität Erfurt und Amerikastudien (M.A.) an der Universität Amsterdam. Berufliche Stationen führten sie u. a. in den Online-Journalismus. 2018 promovierte sie am Institute of Communications Research der University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) mit einer Arbeit zur DDR-Pressetransformation. Für ihre Dissertation erhielt sie den Dissertations-Nachwuchsförderpreis der Fachgruppe Kommunikationsgeschichte der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Aktuell habilitiert sie am Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Medientransformation, Mediengeschichte und kritische Theorien. |
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
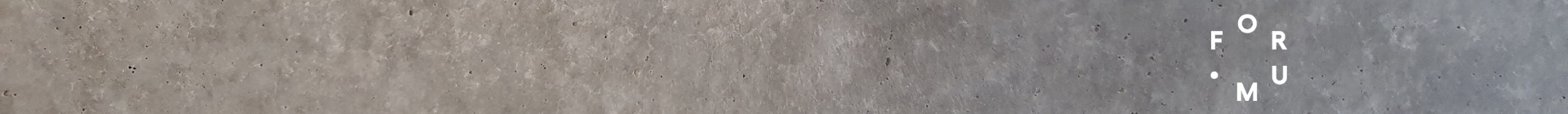

.jpg)