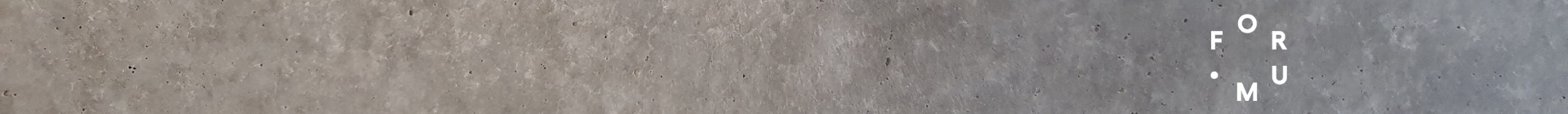Politik in der Wissenschaft. Vom Zweck der Forschung in modernen Gesellschaften
Colloquium Fundamentale im Sommersemester 2022
Wissenschaftliche Erkenntnisse haben unzählige Innovationen ermöglicht und zu einer stetigen Verbesserung unserer Lebensverhältnisse beigetragen. Darum wird die öffentliche Förderung der Wissenschaft häufig mit ihrem gesellschaftlichen Nutzen legitimiert. Doch wie kann der gesellschaftliche Nutzen der Forschung gewährleistet werden? Und worin besteht der Nutzen? Über diese Fragen wird in der Forschungspolitik und in der Wissenschaft zum Teil kontrovers diskutiert. Einige Akteure argumentieren, dass Wissenschaft zu gesellschaftspolitischen Zielen beitragen sollte. Sie wollen dafür gezielt Fördergelder bereitstellen – zum Beispiel, um die Energie- oder die Mobilitätswende zu bewerkstelligen, die Verbreitung von Falschinformationen in Sozialen Medien einzudämmen oder die Pandemie zu managen. Andere Akteure zweifeln, dass sich wissenschaftliche Erkenntnis steuern und ein gesellschaftlicher Nutzen der Forschung gezielt herbeifördern lasse. Der konkrete gesellschaftliche Nutzen wissenschaftlicher Erkenntnis ergebe sich häufig erst im Nachhinein. Ein Beispiel ist die mRNA-Corona-Impfung, die ohne jahrzehntelange Grundlagenforschung nicht hätte entwickelt werden können.
Wie ergibt sich also der gesellschaftliche Nutzen der Forschung? Wie sollten Anreize gesetzt werden und wie können sie gesetzt werden, ohne die Forschungsfreiheit einzuschränken? Welche Potenziale und welche Gefahren bringen politisch gesetzte Anreize im Wissenschaftssystem? Und was ist der Auftrag der Wissenschaft in modernen Gesellschaften? Diese Fragen stehen im Zentrum des Colloquium Fundamentale im Sommersemester 2022. Es schließt damit an das Colloquium Fundamentale des Wintersemesters 2021/22 „Wissenschaft in der Politik. Von den Potenzialen und Problemen einer komplexen Beziehung“ an (weitere Informationen | zu den Aufzeichnungen der Vorträge).
Das Colloquium Fundamentale wird durch den KIT Freundeskreis und Fördergesellschaft e.V. gefördert.
Konzept und Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Senja Post
Organisation: Mareike Freier M.A
Veranstaltungsübersicht
Gelenkt oder geschenkt? Zum Verhältnis von Politik und Wissenschaft in Krisenzeiten
Donnerstag, 28. April 2022, 18 Uhr, Redtenbacher-Hörsaal, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Geb. 10.91, Engelbert-Arnold-Straße 4, EG
Veranstaltung auf YouTube
Zu den Bildern der Veranstaltung
 © Suhrkamp Verlag |
Prof. Dr. Michael Hagner Professor für Wissenschaftsforschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und Lehre gehört in den demokratischen Ländern zu jenen höchsten Gütern, die immer wieder beschworen werden. Allerdings zeigt sich in Krisensituationen – Klimakatastrophe, Corona-Pandemie, Kriegssituation – immer wieder, dass diese Freiheit prekär wird; sei es, dass der Staat bestimmte Forschungsergebnisse erwartet, sei es, dass die Wissenschaften sich öffentlich in einer Weise äußern, die zum politischen Ondit im Widerspruch steht. Was aber ist unter wissenschaftlicher Freiheit zu verstehen? Wie kann sie begründet werden? Wie kann sie in Gefahr geraten? Und welche Ansprüche der Politik an die Wissenschaft sind legitim? Diesen Fragen widmet sich der Vortrag von Prof. Dr. Michael Hagner und argumentiert, dass Freiheit in den Wissenschaften – wie auch in der Gesellschaft – kein einmal erworbenes Gut ist, sondern immer wieder neu befragt, begründet und verteidigt werden muss.
|
Wissenschaftsfreiheit in autoritären Regimen. Das Beispiel der Volksrepublik China.
Donnerstag, 12. Mai 2022, 18 Uhr, Redtenbacher-Hörsaal, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Geb. 10.91, Engelbert-Arnold-Straße 4, EG
Zu den Bildern der Veranstaltung
 |
Dr. Alexandra Kaiser Postdoc beim BMBF-Drittmittelprojekt "Wissenschaftsfreiheit in der Volksrepublik China", Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Das Recht auf Wissenschaftsfreiheit in China operiert in einem autoritären System. Obwohl das nationale Recht Chinas international anerkannte Elemente des Konzepts der akademischen Freiheit kodifiziert hat, unterlag das Recht auf Wissenschaftsfreiheit in der VR China immer Grenzen. Diese normativen und/oder faktischen bzw. willkürlichen Grenzen können sich jederzeit verschieben. In der Ära Xi Jinpings wird die individuelle Wissenschaftsfreiheit durch neue Regularien und Vorschriften allerdings noch weiter eingeschränkt. Auch die universitäre Autonomie, die durch die parteiliche Aufsicht bereits stark beschnitten war und somit durch eine duale Organisationsstruktur gekennzeichnet ist, wird durch politische Entscheidungen, die ideologische und politische Arbeit an Hochschulen zu stärken, noch stärker beschränkt und hat einen chilling effect, auch auf die wissenschaftliche Zusammenarbeit.
|
Chancen und Herausforderungen von Innovationspolitik in einer turbulenten Welt
Donnerstag, 30. Juni 2022, 18 Uhr, Redtenbacher-Hörsaal, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Geb. 10.91, Engelbert-Arnold-Straße 4, EG
Veranstaltung auf YouTube
Zu den Bildern der Veranstaltung
 |
Prof. Dr. Jakob Edler geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe
|
Inwiefern und zu welchem Zweck ist die Wissenschaft frei?
Donnerstag, 21. Juli 2022, 18 Uhr, Foyer des Präsidiumsgebäudes, Engelbert-Arnold-Str. 2, Geb. 11.30, KIT-Campus Süd
In Kooperation mit KIT Academy for Responsible Research, Teaching and Innovation (ARRTI)
Das Verhältnis von Politik und Wissenschaft wird oft als spannungsreich beschrieben. Vor allem die politische Instrumentalisierung von wissenschaftlicher Praxis und Erkenntnis zu ihr fremden Zwecken wird als reales Problem gesehen. Dabei sind Politik und Wissenschaft nicht nur eigenständige Praxen, sondern auch in vielfältiger Weise miteinander verbunden und aufeinander angewiesen.
Die Wissenschaft bedarf demnach offenbar einer ihr eigenen Freiheit und ist zugleich doch eingebunden in ein Gesellschaftsganzes. Wenn wir Wissenschaftsfreiheit als Wert anführen, müssen wir uns also fragen, zu welchem Zweck wir uns auf sie berufen. Die Antwort auf diese Frage ist Voraussetzung für eine Gestaltung der Beziehung von Wissenschaft und Politik, in der die Ansprüche der einen an die jeweils andere Seite als angemessen gelten können.
In dieser letzten Veranstaltung der Reihe wollen wir Vertreter*innen von Politik und Universität ins Gespräch miteinander bringen. Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, wie Wissenschaftsfreiheit verstanden werden muss, um eine angemessene Gestaltung des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Politik zu ermöglichen.
Veranstaltung auf YouTube
Zu den Bildern der Veranstaltung
 © Dirk Brzoska |
Prof. Dr. Pirmin Stekeler-Weithofer Seniorprofessor für Theoretische Philosophie an der Universität Leipzig
|
 |
Politikerin und Mitglied des Europäischen Parlaments (Leider musste Viola von Cramon-Taubadel aus Termingründen absagen.)
|